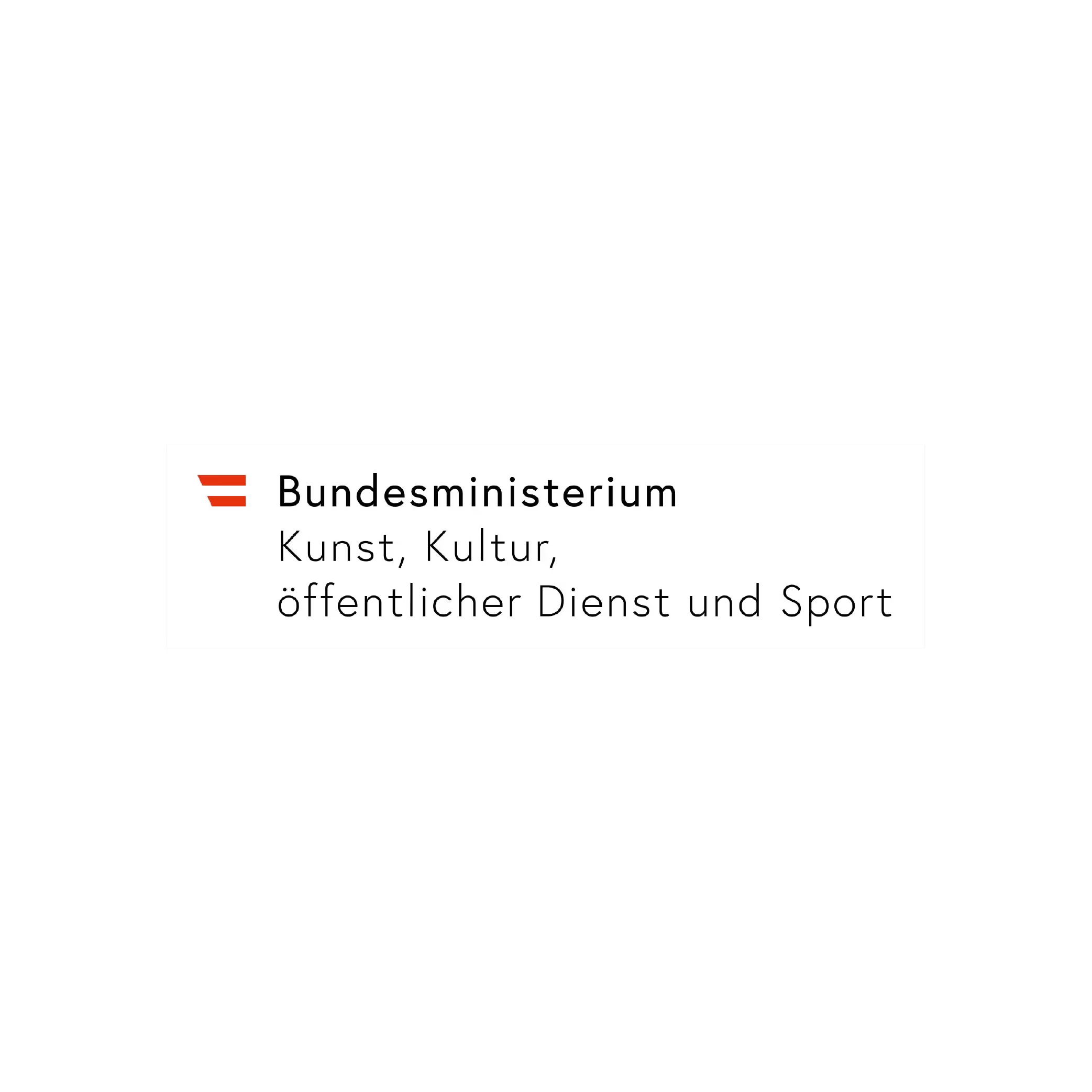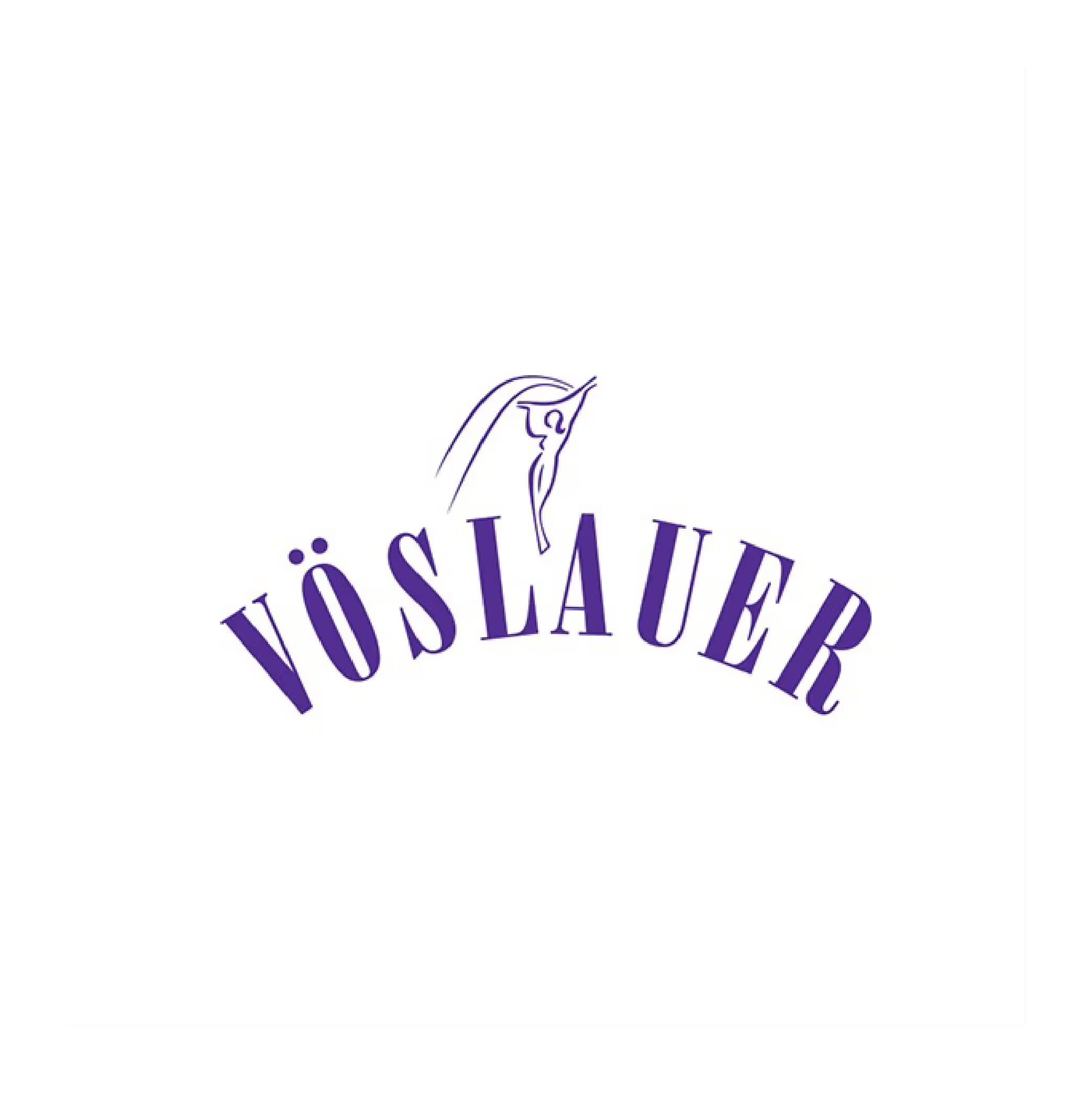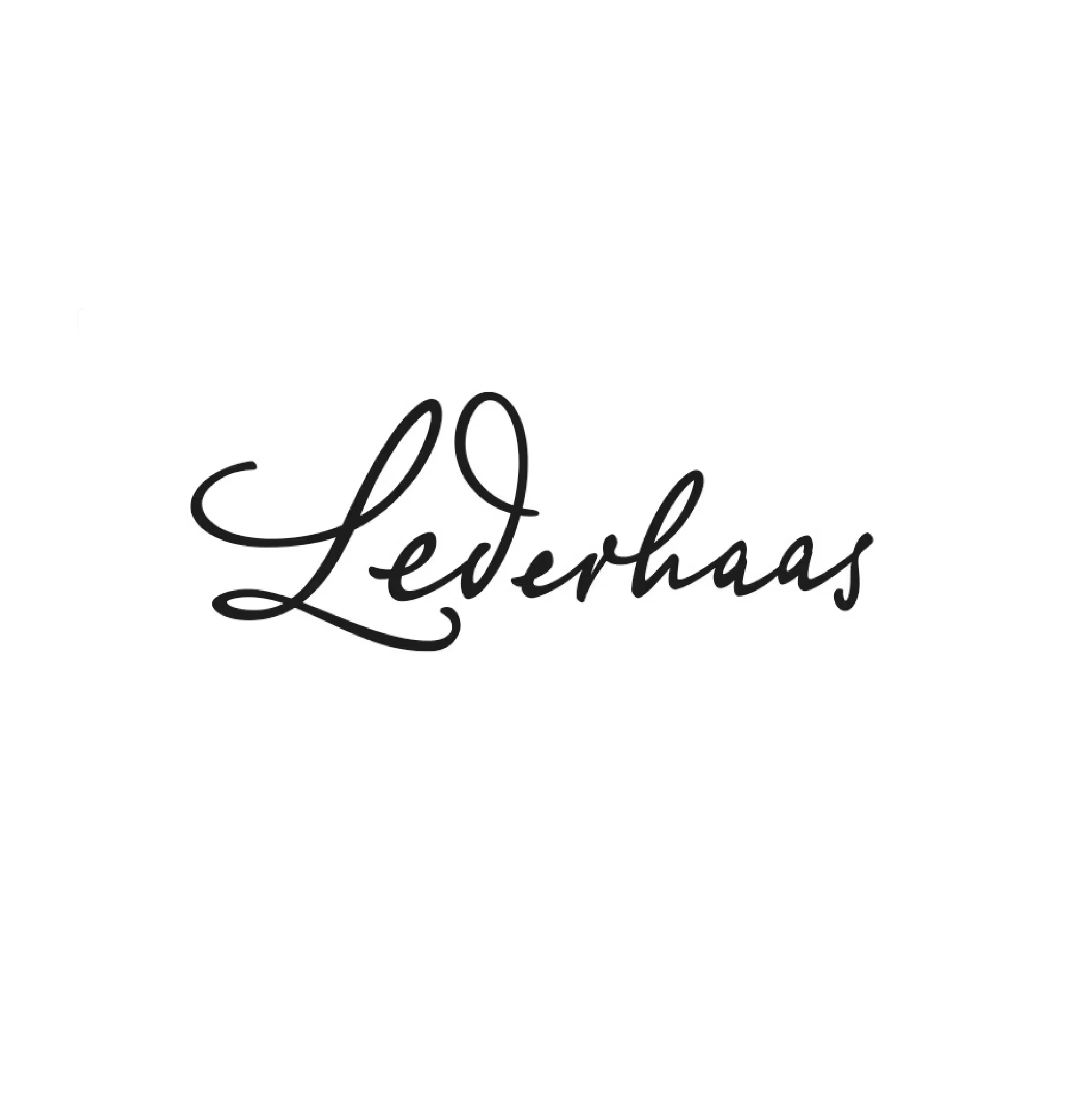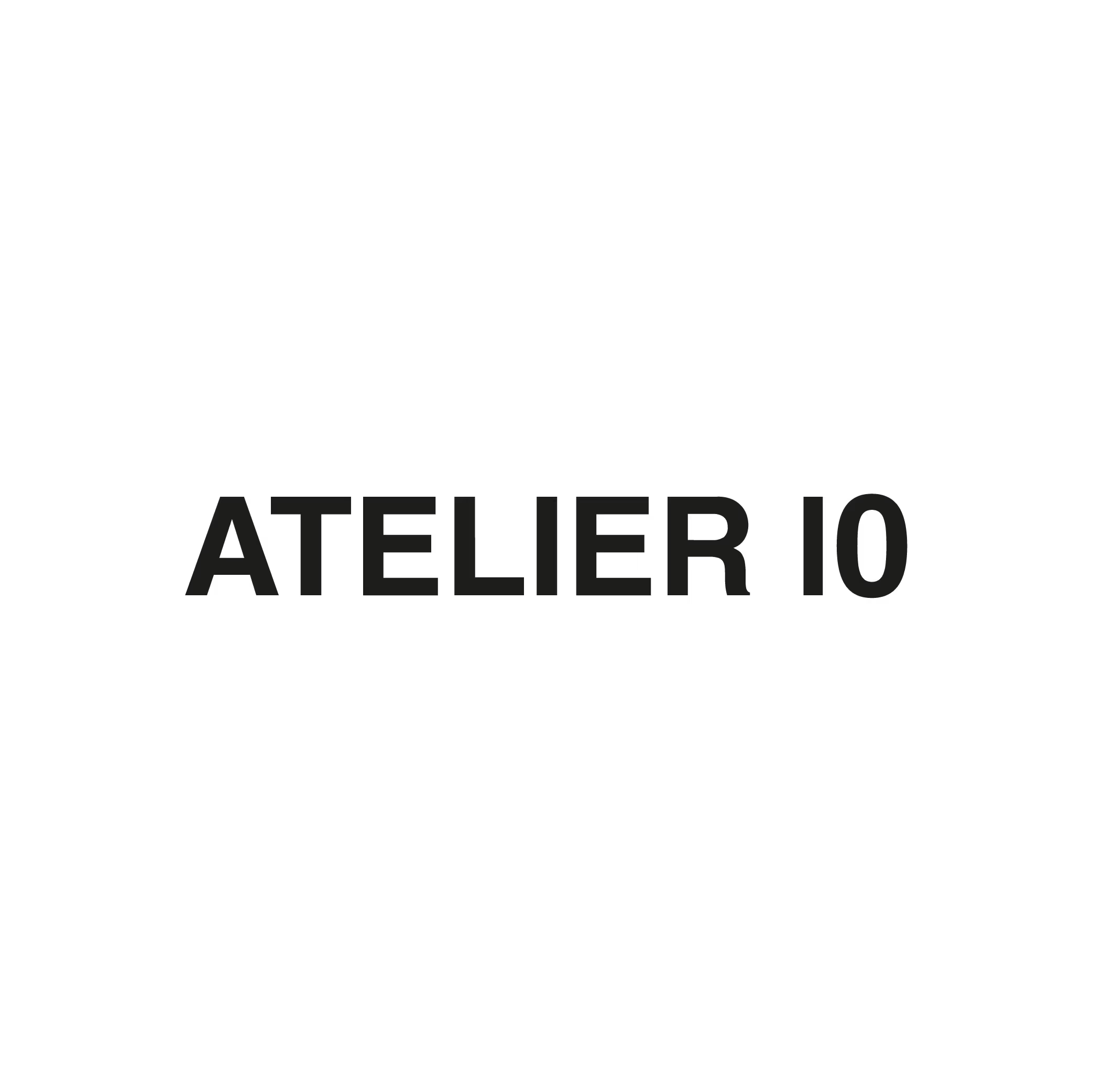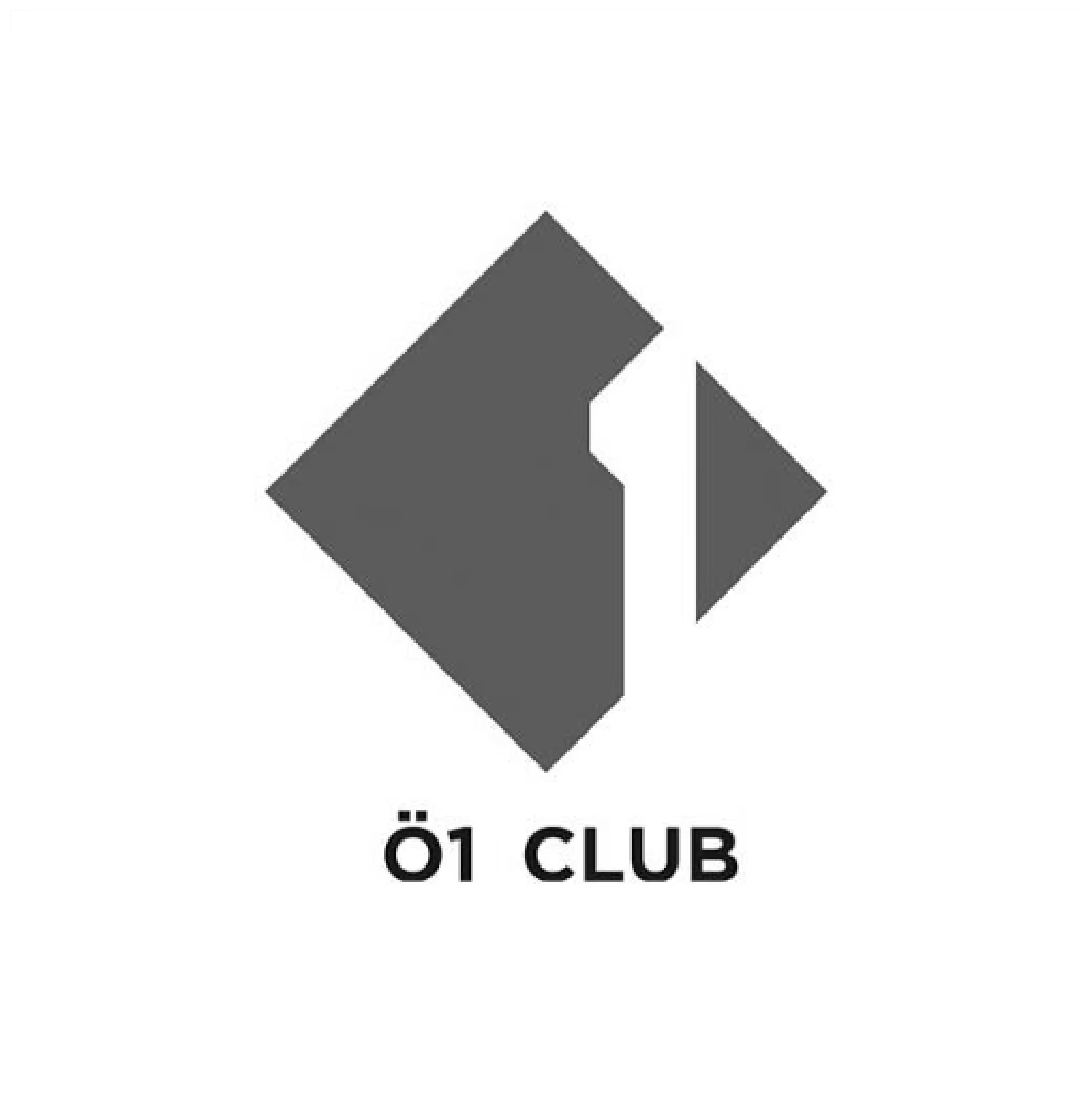Rückblick: Tage der Transformation 2025
„Durch das laute Geschrei der Populisten und die permanente Abgrenzungsrhetorik ist die enorme Kraft der konstruktiven Auseinandersetzung in den Hintergrund getreten. Wir wollen drei Tage lang streiten, staunen, versöhnen, verhandeln und erforschen“, so die Botschaft von Intendant Fabian Burstein an die Gäste im Kolomanisaal des Stiftes Melk 2025. Und weiter: „Wir feiern den Diskurs als Kulturtechnik, dank derer wir endlich wieder ins Verhandeln kommen, wie wir in Zukunft leben wollen.“
„Es geht um das Zusammenkommen, Diskutieren, Austesten, wie eine gemeinsame Zukunft aussehen kann, in der miteinander anstatt übereinander auf Augenhöhe mit Respekt und Achtung gesprochen wird,“ so Stefanie Jaksch, die Kuratorin des Festivals. „Ich bin der festen Überzeugung, dass unser Programm die Möglichkeit und Aufgabe hat, dem Status quo kritisch zu begegnen, ohne dabei weiter zu spalten“, erläuterte Jaksch die Absicht hinter den Tagen der Transformation. „Unsere Gäste und die Vielfalt der Bezüge, die sie zum Thema ACHTUNG herstellen, sind Sinnbild für diese Überzeugung. Ja, wir werden nicht immer einer Meinung sein, aber voller Achtung füreinander und für unsere individuellen Erfahrungen. Denn genau das stellt die Basis für stabile Beziehungen dar.“
Und so standen die diesjährigen Tage der Transformation auch unter dem Motto Achtung, im Alltag meist als Warnung gebraucht, hier aber in einem anderen Wortsinn als Synonym für Respekt. Ein klarer Gegenakzent zur sprachlichen und gesellschaftlichen Aufrüstung unserer Zeit. Nicht als Warnruf, sondern als Einladung zur Hinwendung, zur differenzierten Auseinandersetzung mit den anderen.
Eine Reihe von Veranstaltungen, Ausstellungen, gemeinsamen Aktivitäten, Vorträgen, spielerischen Aktionen und eine beeindruckende szenische Lesung gaben den Rahmen für das dreitägige Coming together im wunderbaren Barock-Rahmen des Stifts Melk.
FREITAG, 29. August 2025
Nigls Crowd – Barocke Fresken und archaische Figuren
Ausstellung im Pavillon des Stifts Melk | 29.08.–31.10.2025
Bereits vor dem offiziellen Auftakt wurden Besucher:innen im Gartenpavillon des Stifts von einer besonderen Crowd empfangen: Franz Nigl ließ eine Horde archaischer Tonfiguren Nigls Crowd auf barocke Fresken treffen – auf Illusion, Erhabenheit und romantisierte Darstellungen ferner Welten. Nigls Figuren fordern Blickkontakt, ohne selbst zu kommunizieren. Sie stehen, verharren, blicken – reduziert, massiv, multipel.
Kurator Florian Reese vom Atelier 10 beschreibt die Wirkung treffend: „Jede Figur scheint ein Abbild archetypischer Tiefstapelei zu sein. Als je Einzelne erscheinen sie starr und simpel, als Gruppe jedoch potenzieren sie sich ins Unheimliche, ins Irritierende, ins Bewegende.“
Für Fabian Burstein ist diese Arbeit programmatisch: „Nigls Crowd ist Sinnbild für die Widersprüchlichkeiten, die wir im Rahmen des Festivals nicht nur aushalten, sondern bewusst forcieren. Diese Figuren stellen uns die Frage: Was bedeutet Achtung, wenn uns das Gegenüber fremd oder sogar beunruhigend erscheint?“ Damit wurde der künstlerische Rahmen deutlich gesteckt. Wenn eine Crowd so anders ist, als wir es gewohnt sind, gilt es mit noch mehr Aufmerksamkeit zu schauen und zu begreifen.
Die Ausstellung ist noch bis Ende Oktober im Gartenpavillon zu sehen – und bleibt ein wortloser, eindrucksstarker Beitrag zur Debatte über kollektive Identität und das Fremde im Eigenen.
Programm
Eröffnung im Kolomanisaal
Asal Dardan über Erinnerung als Widerstand
Im Kolomanisaal eröffnete die Autorin Asal Dardan das Festival mit der eigens für Melk geschriebenen Rede Wie die Vergangenheit unabänderlich war, würde die Hoffnung unabänderlich bleiben. In ihrem Vortrag forderte sie, Geschichte nicht als lineare Abfolge zu betrachten, sondern als räumliches Phänomen – als einen Ort der Auseinandersetzung. Erinnerung, so Dardan, sei nicht rückwärtsgewandt, sondern widerständig. Sie sei Praxis, nicht inhaltsleeres Pathos.
In eindringlichen Worten verband sie persönliche Erzählung mit politischer Analyse: „Gedenken ist keine Pflichtübung, sondern Voraussetzung für das Miteinander in einer diversen Gesellschaft.“ Ihr Beitrag war mehr als ein Vortrag – es war ein ethischer Appell an die Gestaltung unserer Zukunft. Hoffnung, so Dardan muss in einem durchdringenden Blick auf das Vergangene wurzeln – nicht im Wegschauen.
Begleitet wurde der Eröffnungsabend von einem musikalischen Auftritt des Duos Mira Lu Kovacs & Clemens Wenger, die mit Songs ihres Albums Sad Songs To Cry To eine dichte, emotionale Atmosphäre schufen. Musik und Sprache verbanden sich zu einem stimmigen Auftakt.

Eröffnung im Kolomanisaal
Asal Dardan über Erinnerung als Widerstand
Im Kolomanisaal eröffnete die Autorin Asal Dardan das Festival mit der eigens für Melk geschriebenen Rede Wie die Vergangenheit unabänderlich war, würde die Hoffnung unabänderlich bleiben. In ihrem Vortrag forderte sie, Geschichte nicht als lineare Abfolge zu betrachten, sondern als räumliches Phänomen – als einen Ort der Auseinandersetzung. Erinnerung, so Dardan, sei nicht rückwärtsgewandt, sondern widerständig. Sie sei Praxis, nicht inhaltsleeres Pathos.
In eindringlichen Worten verband sie persönliche Erzählung mit politischer Analyse: „Gedenken ist keine Pflichtübung, sondern Voraussetzung für das Miteinander in einer diversen Gesellschaft.“ Ihr Beitrag war mehr als ein Vortrag – es war ein ethischer Appell an die Gestaltung unserer Zukunft. Hoffnung, so Dardan muss in einem durchdringenden Blick auf das Vergangene wurzeln – nicht im Wegschauen.
Begleitet wurde der Eröffnungsabend von einem musikalischen Auftritt des Duos Mira Lu Kovacs & Clemens Wenger, die mit Songs ihres Albums Sad Songs To Cry To eine dichte, emotionale Atmosphäre schufen. Musik und Sprache verbanden sich zu einem stimmigen Auftakt.
SAMSTAG, 30. AUGUST 2025
Praxis, Begegnung, Erfahrung
Ein Vormittag der persönlichen Transformation
Der Samstagmorgen war dem Erleben gewidmet. Während das Kulinarische Kollektiv mit dem Stiftspersonal ein meditatives Gemüseschneiden veranstaltete, das in einem gemeinsamen Suppenritual am Abend mündete, lud Lukas Fürst Holz & Hände parallel dazu zum kreativen Handwerk in die Tischlerei Melk, wo Wünsche und Visionen ausgetauscht und in Holzhände gefräst wurden. Im barocken Kaisergang wiederum gaben Sammlerin Hannah Rieger und Hans Hoffer bei Kunst erfahren eine Einführung in die Ausstellung Art Brut. Die Verbindung von Kunst, Rohheit und Ausdruckskraft wurde spürbar und als zentraler Bestandteil von Achtung begriffen.
Bei allen drei Formaten erlebten die Teilnehmer:innen die konstruktive Kraft des Gemeinsamen. Miteinander aktiv sein, sich ergänzen, befriedigende Resultate erzielen, so lässt sich das Erlebte zusammenfassen.
Resilienz und Würde leben
Ein besonderer Moment des Festivals war die Live-Aufzeichnung einer Sendung der Ö1-Reihe „Im Gespräch“ mit dem Schauspieler Samuel Koch, geführt von Johannes Kaup. Koch, der seit einem Unfall bei Wetten, dass…? querschnittgelähmt ist, sprach offen über Selbstachtung, Verletzlichkeit und künstlerischen Ausdruck. Seine Reflexionen zur Achtung des eigenen Körpers, der eigenen Grenzen und Möglichkeiten berührten tief.
Der intime Dialog im Kolomanisaal bildete die emotionale Grundlage für seinen späteren Auftritt – und stellte eindrucksvoll unter Beweis, dass Resilienz und Würde im Kleinen wie im Großen Grundlagen einer Haltung des Respekts und der Selbstachtung sind.
Es hätte keinen Hinweis darauf gebraucht, dass das Gespräch für eine Radiosendung aufgezeichnet würde, um das Publikum um völlige Ruhe zu bitten. Die klugen Worte des Schauspielers Koch zogen alle in ihren Bann und rührten Herz und Hirn.
Bildung neu denken und der Klimakrise zärtlich begegnen
Die Pädagogin und Bestseller-Autorin Florence Brokowski-Shekete setzte mit ihrem Vortrag einen deutlichen Akzent im Festivalprogramm: Sie zeigte, wie entscheidend Schule als gesellschaftlicher Resonanzraum ist. Ihre Forderung lautete: Bildung müsse transkulturell, sensibel und respektvoll sein – nicht als bloßes Mittel zur Integration, sondern als Raum der Ermächtigung.
In einer leidenschaftlichen Rede sprach sie über die Bedeutung von Repräsentation, von Sprache und über das Potenzial, das im Zuhören liegt. Ihre Botschaft: „Die Art, wie wir Kinder anschauen, entscheidet darüber, ob sie sich gesehen fühlen – oder übersehen werden.“
Wie sich Achtung auch in der Auseinandersetzung mit der Klimakrise manifestieren kann, zeigte Johannes Siegmund. Der Politikwissenschaftler und Publizist warf einen scharfen Blick auf die gesellschaftlichen Reaktionen auf den Klimanotstand. Trotz der Eskalation der Krise dominieren Verdrängung und lähmende Angst.
In seinem Vortrag rief Siegmund zu einem neuen Zugang auf: zärtlich, streitbar, aber handlungsorientiert. Die Zuhörenden diskutierten mit – es entstand ein Dialog, der aus der Ohnmacht herausführte, hin zu gemeinschaftlicher Verantwortung.
Bühne frei für „Protagonist:innen des Wandels – Die Show“
Mit viel Energie und Humor moderierte Hosea Ratschiller die diesjährige Ausgabe der „Protagonist:innen des Wandels – Die Show“. Seit einigen Jahren sind die Protagonist:innen des Wandels“ fester Bestandteil der Tage der Transformation; mit diesem Format holt Globart Menschen auf die Bühne, die sich durch ihr zivilgesellschaftliches Engagement auszeichnen.
In einem unterhaltsamen Format, das an Startup-Shows wie „Die Höhle des Löwen“ oder „Shark Tank“ erinnerte, stellten sich die Initiativen Acker Österreich, Netzwerk Junge Ohren, Breaking Grounds oder das Bürger:innenKRAFTwerk Schönbühel-Aggsbach der Jury – die aus Padres des Stiftskonvents bestand.
Die Show bewies: Veränderung lebt vom Tun. Das Publikum zeigte sich inspiriert – nicht zuletzt durch den Mut, mit dem die Vertreter:innen der Initiativen ihre Visionen verteidigten, wobei sich einige als wahre Talente der Schauspielkunst erwiesen und ihre Anliegen mit Esprit und Humor vertraten.
„Wie aus einem Schneeball eine Lawine wird“: über Macht und Mut
Die ehemalige Skirennläuferin und heutige Aktivistin Nicola Werdenigg sprach als letzte Speakerin des Tages über systemischen Machtmissbrauch – und darüber, wie Achtung und Zivilcourage diese Strukturen ins Wanken bringen können. Sie hatte ihre Erfahrungen schon in ihrer Jugend im Skiverband gemacht und sich entschlossen, im Sinne der nachkommenden jungen Frauen nicht zu schweigen, sondern mutig aufzutreten. So war ihr Vortrag eindrucksvoll persönlich und zugleich von hoher gesellschaftlicher Relevanz. Sie kritisierte mit großer Klarheit das Schweigen der Institutionen, die sich mehr dem Schutz der Täter verpflichtet fühlen als jenem der Opfer.
Im Publikum zeigten sich viele beeindruckt von Nicola Werdeniggs Offenheit und Klarheit. Doch sie blieb nicht bei der Analyse stehen: „Wenn wir beginnen, zuzuhören – wirklich zuzuhören – beginnt Veränderung“, so Werdenigg. Ihre Worte hallten noch lange nach.
Beim abendlichen Suppenritual im Barockkeller fanden Gäste, Teilnehmer:innen und Vortragende in einer besonderen Atmosphäre zusammen, bevor der Schauspieler Samuel Koch mit einer eindringlichen Solo-Performance den Tag beschloss. Seine szenische Lesung von Peter Turrinis Endlich Schluss war intensiv, konzentriert und bewegend. Der große Schriftsteller Turrini war selbst zu dieser Lesung angereist und zeigte sich ebenso beeindruckt wie das gesamte Publikum.
Bereits am Vormittag hatte Koch in einem Ö1-Gespräch mit Johannes Kaup über Selbstachtung, körperliche Autonomie und seine Erfahrungen mit Barrieren – physischen wie gesellschaftlichen – gesprochen. Seine Mitwirkung war ein Höhepunkt des Festivals. Wer ihn beim vormittägigen Gespräch und/oder bei der abendlichen Performance erlebt hatte, hatte viel Stoff für die eigene Reflexion über das Leben erhalten.
SONNTAG, 31. August 2025
Achtung in den Abgründen
Sigrun Roßmanith über forensische Psychiatrie
Den letzten Festivaltag eröffnete Sigrun Roßmanith, forensische Psychiaterin und Psychotherapeutin mit jahrzehntelanger Erfahrung. Ihr Vortrag zeichnete die Verbindungslinien zwischen individueller Missachtung, gesellschaftlicher Verrohung und kollektiver Verantwortung. In klaren, ruhigen Worten sprach sie über das, was oft verdrängt wird: die Verbindung zwischen Biografie, erlittener uns struktureller Gewalt. Ihre Analyse verband individuelle Fallgeschichten mit gesellschaftlichen Mustern und bot neue Perspektiven für das Miteinander in Krisenzeiten.
Ihr Appell: Wenn wir Achtung ernst nehmen, dürfen wir nicht wegschauen. Roßmanith leistete damit einen Beitrag zur gesellschaftlichen Aufklärung – unbequem, aber notwendig.
Zukunft gestalten – im Dialog
Zum Abschluss trafen die Besucher:innen in Workshops erneut auf die Protagonist:innen des Wandels. In praktischen Übungen, Gesprächen und kreativen Prozessen, angeleitet von Christoph Musik (Acker Österreich), Katharina von Radowitz (Netzwerk Junge Ohren), Sarah Wagner (Breaking Grounds) sowie Erich Lagler und Ingrid Garschall (Bürger*innenKRAFTwerk Schönbühel-Aggsbach) konnten eigene Ideen formuliert, Visionen geschärft und Netzwerke geknüpft werden. Die Tage der Transformation endeten so, wie sie begonnen hatten: dialogisch, offen, respektvoll.
Parallel zum Festival fand erneut das Weltklimaspiel© statt – eine Rollensimulation, bei der GLOBART-Stipendiat:innen in die Rollen globaler Entscheidungsträger:innen schlüpften. In mehreren Spielrunden wurden Szenarien verhandelt, Lösungen erprobt, Machtverhältnisse reflektiert.
Ziel: eine nachhaltige Wirtschafts- und Gesellschaftsordnung innerhalb eines „Jahrhunderts“ als Spielzeit zu gestalten. Begleitet von Matthias Mittelberger von der Weitblick GmbH zeigte das Spiel, wie Achtung in politischen und wirtschaftlichen Prozessen wirken kann – als strategische Kompetenz, nicht als moralischer Luxus. Am Sonntag konnten interessierte Besucher:innen eine Spielrunde erleben und sich mit den Stipendiat:innen austauschen.
Die Tage der Transformation 2025 zeigten, dass Achtung mehr ist als Höflichkeit. Sie ist eine Haltung. Eine Haltung, die fordert, irritiert und dabei Türen öffnet – zu Begegnung, zu Erkenntnis, zur Veränderung. Es ist evident, dass wir an einer Gesellschaft des Respekts arbeiten müssen, wenn unser demokratisches Zusammenleben funktionieren soll. Jede und jeder müssen auf diesem Weg ihren Beitrag leisten und aber auch von den anderen mitgenommen werden.
„Wir werden nicht immer einer Meinung sein, aber voller Achtung füreinander“, sagte Stefanie Jaksch zu Beginn des Festivals. Am Ende dieser drei Tage war spürbar: Genau darin liegt die Kraft zur Transformation.
Tage der Transformation zum Weiterhören, Weiterlesen und Weitersehen
- Auf Ö1 ist das Gespräch von Johannes Kaup mit Samuel Koch noch nachzuhören. Infos finden Sie hier
- Die Festschrift „Geborgte Zeit - Eine Anstiftung zum Handeln“ von #aufstehn-Gründerin Maria Mayrhofer ist über das Globart-Büro unter info@globart.at ab 23. Oktober 2025 für 9 Euro erhältlich
- Die Mitschnitte der Vorträge werden nach und nach auf unserem YouTube-Kanal veröffentlicht.
Medienpartner
Jetzt Mitglied werden oder Mitgliedschaft schenken
Globart-Mitglieder profitieren vom Globart-Netzwerk und von vergünstigten Teilnahmegebühren bei allen Veranstaltungen.
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)
.jpg)




















.jpg)
.jpg)